Muskelverspannungen sind ein weit verbreitetes Problem und können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Patient*innen haben in den betroffenen Regionen häufig stechende, ziehende oder brennende Schmerzen.
Muskelverspannungen im Rücken zeigen sich in unterschiedlichen Formen und können verschiedene unangenehme Auswirkungen haben:
- Eingeschränkte Beweglichkeit: Verspannungen können die Beweglichkeit beeinträchtigen und ein Gefühl der Blockierung verursachen. Bei langanhaltenden Verspannungen können sich die Muskeln verkürzen, was zu Bewegungseinschränkungen führt.
- Verhärtung der Muskulatur: Die betroffene Muskulatur kann sich verhärten, wodurch schmerzhafte, tastbare Knötchen oder Wülste entstehen können.
- Schonhaltung: Aufgrund der Schmerzen nehmen Betroffene häufig eine Schonhaltung ein, was die Beschwerden langfristig verstärken kann.
- Weitere Symptome: Infolge von Rückenverspannungen können auch Schmerzen in andere Bereiche ausstrahlen, wie z.B. in die Arme (bei Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich) oder in die Beine (bei Verspannungen im unteren Rücken). Auch Kopfschmerzen können durch Muskelverspannungen im Hals und Nacken verursacht werden.
Psychische Belastungen wie Stress können ebenfalls zu Muskelverspannungen im Rücken führen, da das Gehirn bei Stress Informationen an die Muskulatur sendet, die sich daraufhin anspannt. Langanhaltende Muskelverspannungen führen häufig zu muskulären Dysbalancen und Haltungsschäden.
Eine dauerhaft erhöhte Spannung im Muskel führt dazu, dass das Gewebe schlechter durchblutet und daher mit weniger Sauerstoff versorgt wird. Dadurch kann es zu Mikroentzündungen und nachhaltigen Schäden im Gewebe kommen. Deshalb ist es wichtig proaktiv gegen Muskelverspannungen zu handeln, den Teufelskreis zu durchbrechen und nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Ursachen zu ergründen.
 Prinzipiell kann ein Bandscheibenproblem in jedem Bereich der Wirbelsäule vorkommen, wobei die häufigste Lokalisation im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule (LWS) ist, gefolgt von der Halswirbelsäule (HWS).
Prinzipiell kann ein Bandscheibenproblem in jedem Bereich der Wirbelsäule vorkommen, wobei die häufigste Lokalisation im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule (LWS) ist, gefolgt von der Halswirbelsäule (HWS).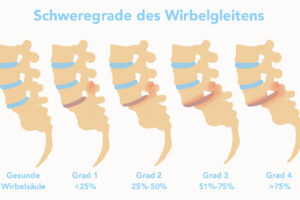 Behandlung
Behandlung